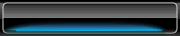Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben
Während in Deutschland eine nie vorher gekannte publizistische Schlacht um Erich Maria Remarques Antikriegsbuch „Im Westen nichts Neues” tobt, reist Jünger Anfang April 1929 mit dem Bruder Friedrich Georg und dem Philosophen Hugo Fischer nach Sizilien. Jünger, der in den zurückliegenden Monaten mit mehreren Buchrezensionen hervorgetreten ist, denkt gar nicht daran, den Sensationsroman des Berliner Journalisten Remarque, der auf Anhieb eine halbe Million Mal verkauft worden ist, einer Besprechung zu würdigen. Dafür stellt er am 7. Februar in der Zeitung „Der Tag” den Sammelband „Wir klagen an! Nationalisten in den Kerkern der Bourgeoisie” vor. Das von Hartmut Plaas herausgegebene Buch erinnert an Attentäter und Partisanen, die nach dem verlorenen Krieg im Ruhrgebiet und in Oberschlesien gegen französische und polnische Besatzer kämpften. Auch literarische Titel wie Alfred Kubins „Die andere Seite” oder Georges Bernanos’ katholischer Roman „Der Abtrünnige” werden ausführlich besprochen, nicht aber das Buch, das eigentlich wie kein anderes Jünger zu einer Replik herausfordern müsste. Allein im Interview zur englischen Übersetzung der „Stahlgewitter” streift Jünger in einer spöttischen Bemerkung den Weltbestseller „All Quiet on the Western Front”. Er schätze es sehr, antwortet er dem englischen Interviewpartner, wenn das Ausland durch den Erfolg des Buches den Eindruck gewinne, Deutschland sei von Internationalismus und Pazifismus beherrscht.
Natürlich weiß Jünger, wie tief die deutsche Öffentlichkeit in dieser Sache gespalten ist. „Im Westen nichts Neues” steht eine Zeit lang sogar in der Gefahr, in Thüringen und Preußen auf den Index zu geraten. Nach der Veröffentlichung im Februar 1929 kommen unzählige Anti-Remarque-Schriften auf den Markt, die sich in meist diffamierender Absicht mit dem Wahrheitsgehalt des Romans oder der Person des Verfassers beschäftigen, man debattiert das Buch in den Parlamenten, beim Militär, in literarischen, kirchlichen und gewerkschaftlichen Kreisen. Bibliotheken verweigern seine Aufnahme, Politiker der Rechten warnen vor dem Kauf und appellieren an den Patriotismus der Leser.
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist gut gewählt, denn die Auseinandersetzung um den sogenannten „Young-Plan”, der die Reparationszahlungen neu regeln soll, und der Streit um den Bau des Panzerkreuzers „Typ A” entzweien Regierung und Parteien. Der Parlamentarismus steuert nach fünf Jahren der Stabilität auf eine Krise zu. Auf selbstzerstörerische Reichstagsdebatten folgen erbitterte Lohnstreitigkeiten im Ruhrgebiet, die Sozialkassen sind leer, das Steueraufkommen sinkt, die Staatsschulden wachsen. Mehr und mehr verlagert sich die politische Agitation auf die Straße, es wird wieder geschossen, Kommunisten und Nationalsozialisten bekämpfen sich mit fanatischer Härte. In dieser aufgeheizten Stimmung wirkt „Im Westen nichts Neues” wie ein Brandbeschleuniger. Seine Kritiker betrachten das Buch als Bedrohung des „Wehrwillens”, der „Völkische Beobachter” empfindet es „als Faustschlag ins Gesicht für alle Frontsoldaten, „die die Erinnerung an den großen Krieg wie ein heiliges Vermächtnis in sich tragen”. Ernst Jünger aber, der Autor, der für sich beansprucht, in seinen Büchern d a s repräsentative Kriegserlebnis dargestellt zu haben, schweigt. Remarques Geschichte um den einfachen Soldaten Paul Bäumer, der von der Schulbank direkt aufs Schlachtfeld geschickt wird, seine Kameraden sterben sieht und am Ende von einer Zufallskugel selbst tödlich getroffen wird, verkörpert für ihn eine Deutung des Krieges, die angesichts der tatsächlichen, elementaren Triebkräfte der Geschichte von hoffnungsloser Naivität ist: Kriege wird es immer geben, und selbst die fortschrittlichsten Mächte sind bis an die Zähne bewaffnet, um ihre Interessen durchzusetzen. Die Schlussfolgerung aus dem verlorenen Krieg besteht für Jünger ja nicht darin, künftig kriegerische Auseinandersetzungen aus humanitären Gründen zu vermeiden, sondern auf den nächsten Krieg seelisch vorbereitet und besser gerüstet zu sein. Nicht der verstörende Schmerz, sondern das reinigende Opfer ist für ihn der Schlüssel zur kriegerischen Wirklichkeit. Remarque dagegen räumt dem Opfer keine über sich selbst hinausweisende Qualität ein, es gibt kein Ziel, das die Aufopferung so vieler junger Menschen rechtfertigt. Beim Anblick der verstümmelten Soldaten im Lazarett kann Paul Bäumer in den Reden vom süßen und ehrenvollen Tod für das Vaterland nur blanken Zynismus der Vätergeneration erkennen, die ihre Söhne in den Massentod hetzt: „Ich bin jung, ich bin zwanzig Jahre alt; aber ich kenne vom Leben nichts anderes als die Verzweiflung, den Tod, die Angst und die Verkettung sinnlosester Oberflächlichkeit mit einem Abgrund des Leidens.”
Muss sich ein Ernst Jünger bei diesen Worten nicht an „Sturm” erinnert fühlen, an seine missglückte Erzählung von 1923, in der er ähnlich verzweifelt nach dem Sinn des Massensterbens gefragt hatte? Und hatte nicht auch er einräumen müssen, dass der Krieg aus ihm einen anderen Menschen gemacht hatte, einen „Arbeitersoldaten”, dem das Töten immer routinierter von der Hand ging? Auch in „Im Westen nichts Neues” findet sich der krude Realismus, wie er Jüngers Kriegsbücher auszeichnet: Sturmangriffe, Nahkämpfe, das einsame Sterben in den Trichterfeldern, die Kameraderie der „Frontgemeinschaft”, die erotischen Eskapaden. Doch dem pazifistischen Roman fehlt jede Verherrlichung des Kampfes als Entfesselung „barbarischer Fülle und Wucht”, die Jüngersche Magie des Schlachtfeldes, auf dem nicht nur Menschen, sondern Werte und Weltbilder aufeinanderprallen im Kampf um eine neue Weltordnung. Für Remarques stille Helden ist der Krieg kein „Schauspiel” und kein „inneres Erlebnis”, sondern eine Lotterie des Todes. Nutznießer des Völkerschlachtens sind die Mächtigen, deren Haupt- und Staatsaktionen sie, die „verlorene Generation”, ausbaden muss, verraten und verkauft von den Waffenlobbyisten und Siegfrieden-Chauvinisten des Großen Generalstabs.
Jünger kann nicht darüber hinweg sehen, dass hier ein begabter Autor erzählerisch bündelt, was die Millionen Kriegsheimkehrer noch immer bewegt, was ihre traumatischen Erinnerungen beherrscht. Auch er hatte ja 1923 davon geträumt, den „großen Zeit-Roman” zu schreiben und war an der Form gescheitert – wie noch einmal 1926, als ein unter seinem Namen und dem Titel „Ferdinand Dark, der Landsknecht und Träumer” angekündigter Kriegsroman nicht erschien. Hier hatte es nun ein anderer geschafft, und das Ärgerliche war: Remarque stand erkennbar auf der anderen, antimilitaristischen Seite, auch wenn er die politische Wirkung seines Buches weder gewollt noch vorausgesehen hatte.
Wie unideologisch Remarque das Thema angegangen war, zeigt die Tatsache, dass er unmittelbar nach Fertigstellung seines Manuskriptes im Frühjahr 1928 für die Zeitschrift „Sport im Bild” fünf Kriegsbücher rezensierte, darunter auch Jüngers „In Stahlgewittern”. In der Besprechung ist die Rede von „wohltuender Sachlichkeit”, das Buch sei „präzise, ernst, stark und gewaltig”, und „ohne jedes Pathos” gebe der Autor „das verbissene Heldentum des Soldaten wieder”. Angesichts dieses überschwänglichen Lobes kann man die Beißhemmung verstehen, die Jünger gegenüber einem Autor empfinden musste, der wie er selbst als Soldat an der Westfront gekämpft hatte und dort schwer verwundet worden war.
Aber auf indirekte Weise antwortet Jünger im „Abenteuerlichen Herzen” dann doch auf Remarques Buch. Es ist ein vernichtendes Urteil. In einem längeren Abschnitt kommt er auf jene „schändlichen” Bücher zu sprechen, in denen der Mensch als schwaches, vom Mitleid gedemütigtes Wesen vorgeführt wird, dem „ein Lumpen nach dem anderen vom Leib gezogen wird, bis dann die ganze Erbärmlichkeit erscheint”. Diese Entwürdigung sei Ausdruck einer durch und durch materialistischen Weltanschauung, in der der Rangunterschied zwischen der tragischen und der sozialen Welt nicht mehr empfunden würde. Dem setzt Jünger die Sehnsucht der Jugend nach Bewährung entgegen, um den verlorenen Einklang mit dem Leben wieder zu finden. Nicht Besitz, Sicherheit und Gerechtigkeit, sondern dionysische Verschwendung, Risikobereitschaft und der Wille zur Macht seien die Prägekräfte wahren Menschentums, postuliert er ganz im Sinne seines Lehrmeisters Nietzsche.
Kein größerer Gegensatz ist denkbar als der zwischen den Schlusspassagen der beiden Bücher, in denen sich bei Remarque tiefe Resignation und emotionslose Knappheit, bei Jünger hochfahrender Opferenthusiasmus und gläubiges Schicksalspathos ausdrückt. Beide handeln vom Tod auf dem Schlachtfeld: Paul Bäumer fällt an einem Tag, „der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den einen Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden…Als man ihn umdrehte, sah man, dass er sich nicht lange gequält haben konnte. Sein Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war”; „Das abenteuerliche Herz” schließt mit der hymnischen Beschwörung des unbekannten Soldaten, dem die Franzosen im Pariser Invalidendom ein Denkmal setzten: „Der weiße Flammenstrahl, der aus dem Asphalt schlägt, sollte der Jugend, die ihn grüßt, ein Symbol dafür sein, dass unter uns der göttliche Funke noch nicht ausgestorben ist, dass es immer noch Herzen gibt, die sich der letzten Läuterung, der Läuterung der Flamme bedürftig fühlen, und dass die Kameradschaft dieser Herzen die einzig erstrebenswerte ist.”
Wie ein Kommentar zu diesen unvereinbaren Positionen liest sich die Kritik von Jüngers Buch, die unmittelbar nach der Veröffentlichung in der evangelischen Literaturzeitschrift „Eckart” erscheint. Der Rezensent konstatiert, Jünger habe wie kein anderer das Geschehen des Weltkriegs positiv gedeutet und dabei auch dem schrecklichsten Leiden einen verallgemeinerbaren Sinn abgetrotzt. Das unterscheide ihn von jenen Autoren, die sich nur mit den materiellen Aspekten der menschlichen Existenz beschäftigten: „Je nach der Tiefe des Menschen und der seelischen Tiefenlage, bis zu der es (das Fronterlebnis, d. V.) eindrang, zerbrach oder gestaltete, nahm es Lebenssinn oder gab welchen. Das erklärt, weshalb neben denen, die im Kriege den Haß lernten und die Gottesleugnung, die anderen stehen, die von ihm aus den Neubau des Volkes versuchten.” Nicht soziale Verantwortlichkeit, sondern kämpferische Verantwortung sei das Gebot der Stunde. Das publizistische Echo bei Jüngers eigentlicher Klientel jedoch ist zurückhaltend, der „Stahlhelm” und das „Deutsche Volkstum” schweigen, im „Militär-Wochenblatt” und in der Zeitschrift „Deutschlands Erneuerung” erscheinen nur Kurzbesprechungen, die Jüngers neues Dichter-Verständnis allerdings wohlwollend kommentieren: „Der gute Soldat und Sturmtruppenführer ist Jünger geblieben, aber er hat die Waffen gewechselt: er ruft zum geistigen Kampf auf.” Auch im „Deutschen Adelsblatt” anerkennt man Jüngers Dichter-Mythos und seinen Anspruch, eine eigene Gemeinde zu bilden, die in ihm den geistigen Führer anerkennt. Für alle diese Lobredner aus dem bildungsbürgerlichen und rechten Lager ist Jünger der Kriegsheros geblieben, der die Mobilisierung der Jugend nun auch mit literarischen Mitteln voranzutreiben beginnt. Gelesen und gekauft wird aber nicht „Das abenteuerliche Herz”, sondern man hält sich weitere an die Kriegsbücher, deren Auflagen unspektakulär, aber stetig steigen.