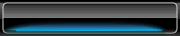Wendezeit - Zeitenwende
Ende der Bescheidenheit?
Junge DDR-Schriftsteller spitzen ihre Federn
Zwischen dem Ruf und der Ankunft des Taxis liegt eine runde
halbe Stunde, knatternd trifft es vor dem „Metropol” ein, Alles
wird bedeutsam, wenn man ins Fremde aufbricht. Der forschende
Blick des Fahrers scheint mir ein bißchen mit Spott unterlegt
zu sein, als ich mein Ziel nenne: „Gabelsbergerstraße.” - „So?
Dort wohnt ein junger, sehr guter Schriftsteller.”
Der Wartburg singt mit hohem Ton die Friedrichstraße hinunter.
Einen Taxifahrer, der auch die literarische Topographie seiner
Stadt beherrscht - wo gibt's das noch? Seltsam übergangslos
aber, als hätte er einen höheren Gang eingelegt, lotst er das Gespräch
in die Politik: Honecker-Besuch, Flaggen-Zeremonie, die
Ewiggestrigen, die den Staatsratsvorsitzenden ausbuhten in
Wiebelskirchen. Was so überraschend harmlos begann, entwickelt
sich gleichsam zum Verhör. Noch ein paar Sätze zur Präambel
des Grundgesetzes, und wir sind am Ziel.
Der Kaffee wird in Keramiktassen gereicht, die der im letzten
Jahr nach West-Berlin übergewechselte Schriftsteller Sascha Anderson
geformt hat. In der stillen Seitenstraße, oben im vierten
Stock, wohnt es sich nicht schlecht. Auf diese geräumige, helle
Wohnung mit ihren hohen Decken haben der Schriftsteller Lutz
Rathenow und seine Frau lange warten müssen. Das Wort „wohnen”
hat hier einen ganz eigenen Klang. Man hat die Mühen der
Suche mitzubedenken, die Anspruche einer Gesellschaft, die das
Private als etwas ihr Entzogenes beargwöhnt. Der Hausherr gilt
als erfolgreicher Wanderer zwischen den Welten und gibt sich
Mühe, befreundeten Schreibkollegen die Tür zum verlegerischen
Wunderland Bundesrepublik einen Spaltbreit zu öffnen.
Mir gegenüber sitzt Detlev Opitz, in dessen Schublade zwei,
drei Romane liegen, der aber wenig Lust hat, sie einem der raren
DDR-Verlage anzudienen. Einen Text von ihm haben sie in
„Sinn und Form” verstümmelt, jetzt schreibt er nur noch in Zeitschriften,
die im Verborgenen blühen. Abends fällt mir dann
prompt eine auf löschblattweiches Papier gedruckte Anthologie
in die Hand, die der Lyriker Rainer Schedlinski aus Anlaß des
Berliner Kirchentags zusammengestellt hat „…rülpsend durch
entsicherten Beton, gelb reflektierend sand, ein minenquadrat,
stiefelleder, einschuf3gesottenes Holz, brünstiges ef-e-Violett,
staubschweißtücher: Ich hab' kein Geld und keinen Samen, ich
bau’ mir ne Mauer, da wacht es sich gut, ich bau' mir ne Mauer,
da stirbt es sich gut.”
Opitz liebt die scharfen, rotzigen Töne, seine Sprache der poetischen
Denunziation ist eine provokative Absage an die „Nischenexistenz”,
die Räume des Begehrens und der subjektiven
Ansprüche werden weit hinausverlegt. Das Angebot, in unserer
Zeitung zu schreiben, kontert der anarchische Geist mit dem
Verdacht, daß auch wir im Westen seine Provokationen nicht ertragen
könnten.
Es fällt schwer, dieser Stadt mit einfachem Staunen, mit der
Unverbindlichkeit des Flaneurs zu begegnen. Es ist ein Sichbelauern
der Menschen, und die von märkischen Kohlewinden
zerfressenen Mauern starren einen an, als wollten sie ihren Platz
zugewiesen bekommen, einen Platz, den die Geschichte ihnen
verweigert. Der Übergangsplatz Berlin zermürbt die eindeutigen
Stand-Punkte, zwei Standflachen stoßen aneinander, und die
Hoffnungen gürten sich mit einem Wall aus Draht und Stein. Michel
Butor nannte Berlin einen „leidenschaftlichen Horchposten”,
der die Erschütterungen der Weltpolitik registriert.
Die Stadt als Instrument: Sie stellt ihre Ansprüche an den
Menschen, und der hat sie abzuschütteln wie einen lästigen
Gast. In keiner Stadt der Welt fragen die Besucher so viel wie hier
in Ost-Berlin, und nirgendwo gleichen die Antworten so sehr einem
Riegel, den der Gefragte vor seinen kleinen Winkel der Geschichte
schiebt. Das beklemmende Gefühl, das die sondierenden
Gespräche zwischen dem Deutschen aus dem Westen und
dem aus dem Osten grundiert, ist Scham. Der eine schämt sich
dafür, daß sein Interesse für den anderen nur aus Neugierde,
Voyeurismus besteht, der andere dafür, daß seine Fragen immer
nur auf den konkreten Nutzen zielen, den der Westgast bringen
konnte. Der aus dem Westen schämt sich, daß sich der aus dem
Osten schämt für die Unzulänglichkeiten, die der Gast im Restaurant,
beim Einkauf, an der Grenze zu ertragen hat. Beide
schämen sich über ihre gemeinsame Geschichte, die ihnen an jeder
Ecke dieser Stadt entgegenblickt.
So zum Beispiel über den Anblick der Sperranlage im Stadtteil
Prenzlauer Berg, Oderbergstraße. Der Osten schiebt sich hier
ganz ungeniert in den Westsektor hinein. Drüben ragt eine Aussichtsplattform,
unter ihr laufen Hundeführer Patrouillen. Zurufe
sind möglich, nur wenige Meter trennen Ost- und Westteil der
Stadt. Wäre dieses Monsterbauwerk in Rom oder Madrid aufgetürmt
worden, fiele es nicht schwer, sich an dieser Stelle einen
verbalen „Grenzverkehr” vorzustellen, eine südländische Heiterkeit,
die die Trennung überspielt. Wir aber starren uns an, in
sprachloser Arroganz. Die da drüben, der größere, erfolgreichere,
selbstbewußtere Teil, von oben herab, wir da unten als Objekte
einer hochmutigen Neugierde, die wie durch ein Gitter in
einen überfüllten Gefängnistrakt zu spähen versucht. Am Vortag
bin ich selbst noch auf einem dieser Podeste gestanden, jetzt
spüre ich hier unten das Fragwürdige solcher Vorrichtungen, die
ein ganzes Land zum Panoptikum machen. Wir starren uns
wechselseitig an und schauen doch nur in den blinden Spiegel
deutscher Möglichkeiten.
Man kann es sich einrichten in Ost-Berlin. Der Wunsch, sich
hier niederzulassen, hat viele Väter. Der „Westen im Osten” ist
Konsumparadies für den, der über Westgeld verfügt. Auch sonst
ist die Versorgung besser als in Leipzig oder Dresden. Auch die
Versorgung mit heruntergekommenem Wohnraum, der sich seit
1980 größter Beliebtheit bei der landmüden Jugend erfreut. Der
Schriftsteller und Fotograf Thomas Günther - Jahrgang 1952, er
hat schon ein Buch im Westen veröffentlicht und zur Buchmesse
erscheint das zweite - bewohnt mit seiner Frau und einem Kind
eine große Altbauwohnung unweit des Alex. Zweimal in der
Woche arbeitet er als Hilfsgärtner auf dem Friedhof, der bis an
das Haus heranreicht, in einer Oase der Ruhe, deren erdige Düfte
durch die großen Fenster in die Wohnung hereinziehen. Aus
dem Baumwipfelteppich ragt grau und spitz der Fernsehturm
und erinnert daran, daß wir uns hier im Zentrum der DDR-Regierungsmacht
befinden und nicht etwa irgendwo in ländlicher
Idylle zwischen Ettersburg und Tiefurt.
Thomas Günther, der Rimbaud übersetzt und den Text mit Fotocollagen
illustriert hat - für die Schublade, denn eine Chance
der Veröffentlichung sieht er nicht -, ist ein Lyriker der neuen
Generation. Der Exodus zahlreicher Künstler und Schriftsteller
nach Biermanns Ausweisung 1976 hat keine Resignation, ganz
sicher aber einen Rückzug aus der Politik, aus dem gesellschaftlichen
Engagement bewirkt. Mit der Entdeckung des eigenen Ich
ging die Entdeckung außergesellschaftlicher Wirklichkeit einher.
Wo sich bei Lutz Rathenow noch die gesellschaftliche Wirklichkeit
in parabelhafter Spiegelung erhalten hat, löst sie sich bei anderen
auf in Sprachstückwerk, das die Sprache des Staates unterwandert.
Geschildert wird die Realität des Alltags, der aus der
Unterdrückungsdialektik von staatlichem Machtanspruch und
gefordertem „produktivem” Einspruch des Künstlers herausgefallen
ist.
„Einer zu sein, der von sich selbst abweicht oder mit seinen
Überzeugungen nichts erreicht” - das Desaster politischen
Agierens im versteinerten Raum der sozialistischen Gesellschaft
treibt auch Thomas Günther um. So führen die meisten poetischen
Wege hinaus aus den Minenfeldern gesellschaftlichen Engagements
in das Experimentierfeld anarchischer Sprachfreiräume:
zu Sprachkonkretisten wie Wittgenstein, Derrida oder Heißenbüttel. Den Experimentierräumen der Sprache entspricht der
Lebens- und Existenzfreiraum, den sich die jungen Autoren erobert
haben.
Die Sophienkirche, Berlins einzige noch erhaltene Barockkirche,
ist überfüllt. Auf handgeschriebenen Plakaten und in hektographierten
Zeitschriften ist der Auftritt von Stephan Krawczyk
unter dem harmlosen Titel „Werkstatt der offenen Arbeit” angekündigt.
Der Liedermacher ist republikweit bekannt. Angefangen
hatte er vor Jahren mit einem Repertoire an Brecht-Liedern,
dann engagierte er sich im „Friedensdienst” und ist als pointierter
Kritiker des DDR-Staates inzwischen auch den Kirchenoberen
zum Problem geworden. Krawczyk, untersetzt, mit kurzgeschorenem
Haar und dunklen Augen, besitzt eine auffallende
Ähnlichkeit mit seinem Vorbild Bert Brecht. Die Stimme aber hat
nichts von dessen Schneidigkeit, sie ist dunkel-sonor, von behäbiger
Freundlichkeit.
Weniger freundlich sind gleich zu Beginn des Konzerts seine
Vorwürfe an die Kirche, die seit März dieses Jahres seine Auftritte
in kirchlichen Räumen einzuschränken versucht: „Feigheit
und fehlende Konfliktbereitschaft” wirft er den Zuständigen vor.
Daß er diese Konfliktbereitschaft besitzt, beweist der Liedermacher
in seinem Bänkellied „Der Staatsfeind”. Mit einer jetzt
schneidend-aggressiv gewordenen Stimme singt Krawczyk von
der „DDR”-Sprache, „die uns an die Leine legt”, und verhöhnt
den Zweckoptimismus der Parteitagsdelegierten. Unter dem Apsisbogen
der Kirche, dessen Schlußstein sinnigerweise von einer
schneeweißen Friedenstaube geschmückt ist, intoniert er eine
Hymne des Widerstands („Mein Programm heißt Widerstehn!”)
- ein Brecht-Epigone, der in Gestik und Stimmfülle
zum Biermann-Konkurrenten aufläuft.
„Treibt’s nicht zu weit, ansonsten kommt die Sicherheit”: Die
Rede von der tickenden Bombe im Wahllokal, von Reiseverbot,
Schießbefehl, vom „Balance-Akt” auf der Mauer, von der brutal
unterdrückten Demonstration auf der Ostseite des Brandenburger
Tors, seine Parodie auf das Stadtjubiläum, die stürmisch gefeierten
Songs zu Gitarre und Zieharmonika müssen selbst einen
stenographiegewandten Stasi-Mann ins Schwitzen bringen.
Stephan Krawczyk ist auf Konfrontationskurs, will den Dialog
mit der DDR-Regierung herbeizwingen - und ist schon dabei,
sich aus dem Resonanzraum der Kirche hinauszusingen. Er, der
ein offizielles Berufsverbot vorweisen kann und auch ins „befreundete”
Ausland nicht mehr reisen darf, sieht offensichtlich
das Ende der Bescheidenheit für gekommen. Die Tragik dabei
ist, daß er mit seiner bewundernswerten Entschiedenheit das
komplizierte Verhältnis Kirche - Staat durcheinanderzubringen
droht. Erste „Ordnungsstrafen” gegen kirchliche Stellen, die ihn
spielen und singen ließen, wurden schon verhängt.
Eine Straße führt weg von der Sophienkirche, zwischen wie
aus schwarzer Pappe geschnittenen Häuserfronten hindurch.
Fenster glühen gelb über bröckelnden Gesimsen. In Müll- und
Bauschuttbergen suchen Betrunkene ihren Weg durch eine
Landschaft des Verfalls. Ich durchmesse Kubins Patera-
Alptraum auf meinem einsamen Gang durch das nächtliche
Ost-Berlin.
Die „Möwe” in der Maternstrage, unweit der Friedrichstrage,
ist fast unter eine stählerne Eisenbahnbrücke gedrückt. Luster
schimmern durch halbverhängte Fenster, Gläser klirren und Barmusik
sickert auf die schlechtbeleuchtete Straße. Im „Künstler-
Club” trifft sich die Ostberliner Kultur-Schickeria. Wir werden
abgewiesen, dem Autor, der mir Einblick gewahren wollte
in den verschwiegenen Vergnügungsplatz einer angepaßten
Kulturelite, die es in diesem Staat eigentlich nicht geben dürfte,
droht man mit der „Meldung beim Schriftstellerverband”. Man
fürchtet das lose Mundwerk alkoholisierter Künstler und in
westlichem Schick gekleideter Wichtigtuer, die das Bild des verantwortungsbewußten
„Kulturschaffenden” trüben konnten.
Erneute Scham über die Prozeduren, mit denen man Menschen
trennt - ein zuverlässiges deutsch-deutsches Gefühl?
Von der Sophienkirche zum Künstlerclub: Ein Gang durch die
Nacht Ost-Berlins lehrt, daß es noch andere Mauern in Berlin
gibt, Mauern, an denen nicht geschossen wird.