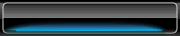Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben
Die Tagespost, 24. November 2007
Zwischen dem Nichts und der Unendlichkeit
Ernst Jüngers Jahrhundertleben in einer mustergültigen Biographie
Von Urs Buhlmann
Er fehlt. Auch bald zehn Jahre nach dem Tod Ernst Jüngers ist niemand erkennbar, der seinen Platz einnehmen könnte. Der kühle Beobachter des Fatums, dessen Lebensspanne mehr als ein Jahrhundert fasste, der „Anarch” - zugleich in der Zeit und neben der Zeit - der unbeirrt seiner Wege geht - er ist einer, den es vorher nicht gab und nicht mehr geben wird. Das Interesse dauert an. In einer neuen Biographie behandelt Heimo Schwilk auch die Frage, die als finale Pointe über diesem „Jahrhundertleben” steht, Jüngers Konversion zur katholischen Kirche.
Im Mittelpunkt stehen die Freiheitslehre und Konversion
Schwilk hat die Aufgabe, dieses 102-jährige Leben zu schildern, glänzend gelöst. Er stützt sich dabei nicht nur auf das Werk, sondern auch auf den historischen Hintergrund. Vor allem lässt er unterschiedliche Wegbegleiter zu Wort kommen, die dem Autor in Zuneigung oder Abneigung verbunden waren. Der wichtigste Gesprächspartner war sicher sein Bruder, der Dichter Friedrich Georg Jünger, eine genuin eigene Begabung, der dem Älteren den Ruhm nie neidete. Das Verhältnis zu Carl Schmitt blieb wechselhaft, was auch mit dessen Rolle als politisch Handelnder im NS-Staat zu tun hatte. Zu Benn entstand jedenfalls keine Freundschaft. Sie - und viele andere mehr - kommen zu Wort. So gelingt Schwilk ein mit allen Lebensfarben gemaltes und nie hagiographisches Tafelbild Ernst Jüngers. Auch die weniger angenehmen Seiten des Autors scheinen auf, die in jungen Jahren maßlose Arroganz etwa. Vor allem aber zwei Aspekte sind es, die Schwilks Interesse finden: Das, was man die „Freiheitslehre” Jüngers nennen könnte und die Motivation seiner zwei Jahre vor dem Tod 1996 erfolgten Konversion zur katholischen Kirche.
Schwilks These ist, dass Ernst Jünger die Rolle des Einzelgängers und „Anarchen” nicht selbst wählte. Das Gefühl der Fremdheit, die Frage: „Was habe ich hier zu schaffen - wie komme ich hierher?”, dieses Geworfen-Sein in die Welt, das Nichtdazugehören sei schon dem Knaben ein Problem gewesen. Von daher seit früher Jugend die Fluchtbewegungen in die Welt von Natur und Literatur. Dazu trat die Ahnung eigener Schuld, nicht aufgrund von Taten, sondern quasi als menschliches Erbteil und Wurzel der eigenen Existenz. Diese „seelische Hypothek” erkläre Jüngers lebenslanges Metaphysikverlangen. Später wird er durch die Lektüre von Hans Jonas lernen, dass dieses eigentümliche Lebensgefühl der antiken Gnosis entstammt. Seit der Jugend ging er immer nur eigene Wege: „Die Fragwürdigkeit der eigenen Existenz ist auch Ursache eines manchmal verwegenen Mutes, der keine Angst vor Todesgefahr kennt, ja diese geradezu zu suchen scheint. Als wäre der Tod die Aufhebung des Schuldgefühls und eine Rückkehr in den mütterlichen Ursprung des Lebens.”
Dieser Mut wird ihm 1918 den höchsten preussischen Kriegsorden „Pour le Mérite” einbringen. Als Haltung findet er auch - gelegentlich selbstgefällig - Eingang in das Frühwerk, so etwa in den „Stahlgewittern”. Doch ist dieser Erstling, den manche seiner Kritiker Jünger bis heute nicht verzeihen, bereits Weltliteratur. Jüngers lakonischer Stil, bei dem kein Wort verschwendet wird, ist vor allem eben das: Bewusster, anerzogener Wille zum Stil. Der Autor spricht einmal vom „ameisenhaftes herumminieren” am Text, bis alles passt und das einzig richtige Wort gefunden ist.
Mag sein, dass die zu Lebzeiten meist unfrohe Aufnahme von Jüngers Werken durch deutsche Autoren da und dort auch schlichtem Neid auf Jüngers Vermögen zur Form entsprang. Sein Hang zum Eskapismus wird ihn zeitlebens begleiten, ob er ihm durch Reisen in tropische Länder noch im Alter oder durch Drogen-Experimente nachgibt. Dieser unbürgerliche Zug Jüngers kann nur den irritieren, der mit dessen gleichsam naturrechtlichen Elitedenken nichts anzufangen weiß. Für den sich gemeinsam mit dem LSD-Entdecker Albert Hofmann - er lebt noch 101-jährig - an synthetischen Stoffen Berauschenden war klar, dass nicht jedem alles erlaubt ist.
Eine schon früh erkennbare metaphysische Traditionslinie
Jüngers Freiheitsbegriff wandelt sich vom wagefrohen Nonkonformismus des Soldaten - „Übrigens gehört es zu meinen Maximen, dass uns die Freiheit immer gewogen bleibt, solange wir mit dem Tode als Dritten im Bunde einverstanden sind” - zur Haltung einer „Désinvolture”. Gemeint ist nichts weniger als eine „göttergleiche Überlegenheit”, die sich dem Wissen um eine höhere Wirklichkeit verdankt. Jünger versteht dies als eine besondere Form der Heiterkeit, als genuin menschliche Waffe des Geistes gegen die Schrecknisse der Zeit. Viktor Frankl beschreibt Ähnliches, wenn er von der „Trotzmacht des Geistes” spricht, die ihm half, das KZ zu überleben.
Der Frage, wie involviert der nationalistische Schriftsteller Jünger in das NS-System war, weicht Schwilk nicht aus. Er bietet eine sorgfältig abgewogene Antwort und zieht dabei den Vergleich zu dem ungleich mehr belasteten Carl Schmitt. Letztlich konnte Hitler, der um ihn buhlte, einen wie Jünger nicht für sich gewinnen, weil die Differenz zwischen der aristokratisch-elitären Ordnung, wie Jünger sie erwog, und der Massen-Diktatur der Nazis zu deutlich war. Im Schlüsselroman „Heliopolis”, 1949 vollendet, gibt Jünger über sein Staatsdenken Auskunft und lässt dabei auch erkennen, dass der demokratische Verfassungsstaat, der sich am Rhein zu formieren begann, gleichfalls nicht seinen Gefallen fand - wegen der Übermacht des „Technischen”. Jünger war nun zum einsamen „Waldgänger” geworden: „Im Waldgang betrachten wir die Freiheit des Einzelnen in dieser Welt”, schreibt er 1951 im gleichnamigen Buch. Er fordert, dass der Einzelne Substanz gegen den Substanzverlust zu setzen, das Individuum gegen das Kollektiv zu repräsentieren habe: „Wenn alle Institutionen zweifelhaft (...) werden und man selbst in den Kirchen nicht etwa für die Verfolgten, sondern für die Verfolger öffentlich beten hört, dann geht die sittliche Verantwortung auf den Einzelnen über.”
Es hatte sich etwas geändert seit jenen Tagen, da er kaltschnäuzig den eigenen Tod und den der Anderen guthieß, wenn dies nur ehrenhaft geschehe. Noch 1932 hieß es freudig im „Arbeiter”: „Das tiefste Glück des Menschen besteht darin, dass er geopfert wird.” Diese unheimliche Emphase verlor sich in einem langen Leben. Schwilk weist eine schon früh erkennbare metaphysische Traditionslinie auf, die dann, in der Gesamtschau, des Schriftstellers Bekenntnis zur römischen Kirche am Ende seines Lebens erklärt. Als junger Offizier verstand er sich als Monist in der Nachfolge Haeckels, der von einem einzigen Seinsprinzip, der „Substanz” ausging, vor dem Existenz oder Nichtexistenz keine Gegensätze sind. Der im Schützengraben Ausharrende bestand darauf, dass der Tod kein Schrecken sei, sondern „Rückkehr aus der Zeit in die Ewigkeit, aus dem Raum in das Unendliche, aus der Persönlichkeit in jenes Große, das alles im Schoße trägt”. Doch geht es dabei schon um Gott?
Dazu bedurfte es weiterer Dezennien und weiterer Anregungen auf Jüngers Lebensweg. Zum einen bekennt er, dass er auch im Krieg niemals Zuflucht im Gebet gesucht habe. Zum anderen beginnt er nach 1918 mit der Lektüre von Ignatius und von Grácians „Handorakel”. Später, im Zweiten Weltkrieg, kommt die Bibellektüre dazu, die er bis zum Tod fortsetzt. Sie hilft ihm, den Bombenkrieg als Kampf mit den Mächten der Finsternis zu deuten. Für Jünger sind Bibel und Offenbarung ein Gleiches, das man nicht auf „Wissenschaftlichkeit” abklopfen dürfe. Die Textkritik, die er an den Schriften Bruno Bauers studiert, vermittle genauso wenig Einsicht in die Bibel wie der Darwinismus Aufschluss über das Tier. Daher verfehle Textkritik an der Bibel die mythische Wirkungsmacht Christi, der als „ewiger Mensch” seinen Ursprung jenseits der Zeit habe. Aber auch mit der Schrift verfügte Jünger noch lange nicht über Glaubensgewissheit: „Die Existenz auf diesem vorgeschobenen Bogen wird mit jedem Tag unhaltbarer, falls nicht von drüben spiegelbildlich ihm die Entsprechung, die Vervollkommnung entgegenwächst. Aber das andere Ufer liegt in dichtem Nebel - und nur zuweilen dringen unbestimmte Lichter und Töne aus der Dunkelheit.”
Der Papst hat „Die Schere” mit Wohlgefallen gelesen
Das Schreckliche, das er gesehen hatte, prägte ihn. So distanzierte er sich gegen Kriegsende in einer Friedensschrift klar vom Nihilismus und rät zur „Zauberklinge des Wortes”, was nichts anderes als den Glauben an das fleischgewordene Wort meint. Kritik hat diese Wandlung vom Nationalisten, der nahe am Nichts gebaut hatte, zum christlich geprägten Metaphysiker durchaus erfahren, wie auch nicht?
Ganz unbemerkt hatte die Zuwendung zur Kirche - im schwäbischen Wilflingen, wohin Jünger 1950 zog, konnte dies nur die katholische sein - eingesetzt. Mit dem Ortspfarrer verstand er sich gut. 1990 erhält er eine Urkunde mit dem Segen Johannes Pauls II., der ihm auch mitteilen lässt, er lese „Die Schere” mit Wohlgefallen. Im Gespräch mit dem Priester wird die Frage des persönlichen Gottes thematisiert. So kommt es 1996 in Wilflingens Pfarrkirche zur Konversion. Schon zuvor hatte er sich aktiv am Gemeindeleben beteiligt. Es war mehr als Verbundenheit mit dem lokal Üblichen, die Jünger diesen Schritt gehen ließ.
Die Distanz zur evangelischen Kirche seiner Kindheit war gewachsen. Im Tagebuch führte er Klage über die Verweltlichung des evangelischen Pfarrers, über den Verlust der Transzendenz in der Predigt. Wie sollte auch ein Jünger, fragt Schwilk, sich in einer Kirche, die mit Bultmann das Geheimnis des Glaubens zu entzaubern begann, als eschatologisch Denkender heimisch fühlen? Durch lebenslanges Nachdenken über die Begriffe von Opfer und Wandlung war sein Denken je schon auf das Katholische gerichtet. Die Frage, ob denn Jünger als vollblütiger Katholik zu gelten habe, verneint Schwilk jedoch. Sie tritt auch zurück hinter einem so langen Aneignungs- und Wandlungsprozess.
Heimo Schwilk ist ein kundiger Führer auf dem Lebenspfad eines Schriftstellers, der aus der Literatur des 20. Jahrhunderts hervorsticht. Was für ein Weg, was für ein Mensch, der zum Totengedenken an den gefallenen Sohn 1992 ein Gedicht schreibt, das mit „Ich klopfe an, ich klopfe an, ich klopfe an” beginnt und endet mit: „Amen. Dank”! Schwilks Buch ist ein Gewinn.
Kritik Jünger - Der Spiegel
Kritik Jünger - Junge Freiheit